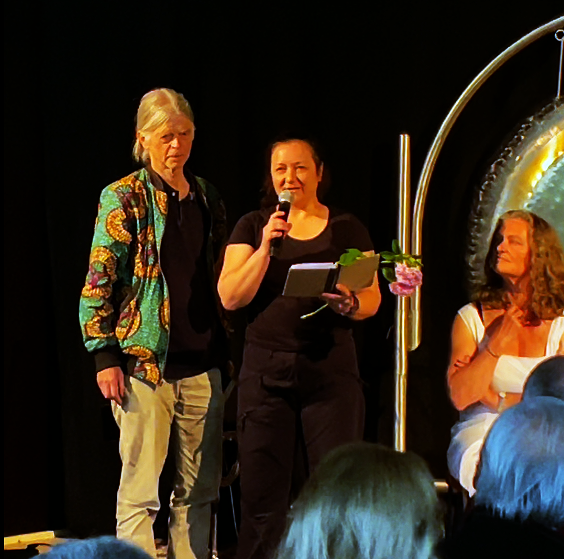Rückblick Rilke Symposium 2025
Rückblick Rilke Symposium 2025
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.
Aus: Neue Gedichte (1907)
Vorträge und Redner
Vorträge und Redner

Er hat eine unglaublich tolle Rilke Biografie geschrieben - "Rilke. Der ferne Magier". Gunnar Decker wuchs in Bad Doberan auf. Er studierte Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 1991 arbeitete er mit einem Promotionsstipendium an der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel 1994 wurde er an der Humboldt-Universität mit einer Dissertation über Gottfried Arnold promoviert. Seit 1995 arbeitet er als freiberuflicher Film- und Theaterkritiker, seit 1997 als Buchautor. Mit seiner Frau Kerstin Decker veröffentlichte er im Jahr 2000 einen Band Essays. Er ist Verfasser biografischer Bücher zu Ernst Jünger, Hermann Hesse, Gottfried Benn und zu Rilkes Frauen. Seit 2008 schreibt er als Redakteur für die Zeitschrift Theater der Zeit. Er lebt in Berlin.

Vorträge von Gunnar Decker
Rainer Maria Rilke – Vom Schreiben einer Dichterbiographie, vom Sprechen über Dichtung
Von Gunnar Decker
In seinem ebenso schmalen wie großräumig gedachten Prosawerk, den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, an denen Rainer Maria Rilke von 1904 (da war er in Rom) bis 1910 arbeitete – die Schlussredaktion erfolgte beim Insel-Verlegerehepaar Anton und Katharina Kippenberg in Leipzig –, hält der Autor der Großstadt der modernen Welt Paris den Spiegel vor. Ein Satz von ihm wird darin gleichsam zur Selbstermahnung: Er war Dichter und hasste das Ungefähre.
Zur gleichen Zeit schrieb er in Paris seine „Neuen Gedichte“, darunter den berühmten „Panther“ im Jardin des Plantes. Hier wie dort geht es um den Preis des modernen Lebens: Entfremdung, Einsamkeit, Ausgeliefertsein an anonyme Mächte, Verlust religiöser Bindungen. Rilke ist ein Seismograph dieser Umbrüche, aber auch einer, der eine neue Sprache findet, um diese Erschütterungen dichterisch zu bannen.
Schon früher, in den Jahren 1899 bis 1903, hatte er mit dem „Stunden-Buch“ – dem „Buch vom mönchischen Leben“, dem „Buch von der Pilgerschaft“ und dem „Buch von der Armut und vom Tode“ – einen dichterischen Zyklus geschaffen, der in ganz eigentümlicher Weise das Verhältnis von Mensch, Welt und Gott neu auslotet.
Rilke war kein religiöser Dichter im konfessionellen Sinne, wohl aber ein spiritueller Suchender, der das Sprechen über Gott als eine existentielle Notwendigkeit erlebte. In seinen Versen wird Gott nicht als feste Größe, sondern als etwas zu Werdendes, als Möglichkeit, als „Gott im Werden“ erfahrbar. Und damit stellt sich Rilke in die große Tradition der Mystik, zugleich aber transzendiert er sie in eine Sprache der Moderne.
„Wir sind die Treibenden. Aber der Schritt der Zeit, nehmt ihn als Kleinigkeit im immer Bleibenden.“ – So heißt es im „Buch von der Armut und vom Tode“. Rilkes Lyrik versucht, im Flüchtigen das Dauerhafte, im Augenblick das Ewige zu erfassen. Dies ist ein dichterisches Projekt von größter Radikalität.
Für Rilke ist Kunst nicht Dekoration, nicht „Versilberung“ des Gewöhnlichen, sondern ein Ausbruch aus den Ketten der Gewohnheit: „Wir sind alle in Ketten geboren. Der und jener vergißt seine Ketten: er läßt sie versilbern oder vergolden. Wir aber wollen sie zerreißen. Nicht mit häßlicher und wilder Gewalt; herauswachsen wollen wir aus ihnen.“
In diesem Sinne ist Dichtung für ihn eine Form der geistigen Übung, ein Ringen um Sprache, die dem Unsagbaren Raum gibt. Sie ist ein Weg zur Freiheit, ein Durchbruch in eine tiefere Wirklichkeit.
Dass wir uns heute, mehr als hundert Jahre später, in Schrems in Niederösterreich zu einem Rilke-Symposium versammeln, ist Ausdruck dafür, dass diese Stimme noch immer nachklingt und uns etwas zu sagen hat. Nicht zuletzt in Zeiten, in denen Religion und Spiritualität neu befragt werden, kann Rilkes Werk Anstoß und Orientierung zugleich sein.
(Pfingsten 2025, Einführungsworte zum Rilke-Symposium in Schrems)
Rilke als Gottsucher? Der Weg vom "Stundenbuch" zu den "Duineser Elegien"
"Er war in gewisser Hinsicht der religiöseste Dichter seit Novalis, aber ich bin nicht sicher, ob er überhaupt Religion hatte. Er sah anders. In einer neuen inneren Weise."
Robert Musil, Rilke-Feier 16. Januar 1927
Von Gunnar Decker
Wie sie wissen, ist Rilke katholisch getauft worden, wuchs in der katholische Stadt Prag als Sohn einer sehr katholischen - aber durchaus emanzipierten - Mutter auf, an der er sich lebenslag abarbeitete. Wie auch an der Religionsthematik, die sich jedoch im Laufe seines Lebens durchaus anders akzentuiert darstellen wird. Den Bogen möchte ich hier mit allen der Zeit geschuldeten Raffungen skizzieren - ein passendes Thema zu Pfingsten vielleicht.
Rilke wurde katholisch getauft, katholisch erzogen - aber trat kurz vor seiner Heirat mit der Bildhauerin Clara Westhoff (die protestantischer Herkunft war) aus der Kirche aus - was jedoch keinen Eingang in seine Ehe-Urkunde fand, in der seine Konfession als katholisch angegeben wurde. Das wiederum wird sich dann als ernsthaftes Hindernis bei der von Clara gewollten Scheidung erweisen - so dass das Nicht-Mehr-Paar dann formell bis an sein Lebensende verheiratet blieb.
Die Zuwendung zur Religion als ein über das bloß Endliche hinausgehender Impuls ist von Anfang an ebenso stark, wie seine Ablehnung ihrer kirchlich-institutionalisierten Form. In seinem "Florenzer Tagebuch" schreibt der zweiundzwanzigjährige 1898: "Die Religion ist die Kunst der Nichtschaffenden. Im Gebete werden sie produktiv: sie formen ihre Liebe und ihren Dank und ihre Sehnsucht und befreien sich so."
Auch Rilkes frühe Gedichte, die dann Eingang ins "Stunden-Buch" finden, das dann erst 1905 (Jahre nach ihrem Entstehen) erscheint, werden die Nähe des Gebets zum Gedicht kultivieren. Stunden-Gebete sind ein Teil klösterlichen Lebens, Rilke fühlt sich um 1900 als ein Pilger (er hat gerade zwei Russland-Reisen mit Lou Andreas-Salomé hinter sich), als "Mönch" sogar, der über Askese und Franz von Assisis urchristliche Ideale der Eigentumslosigkeit nachdenkt.
Das hat bei ihm aber immer einen Hintergrund, der den Dichter zeigt. Sein Fin-de-Siecle-Gefühl sagt ihm gegen jene Jugendstilornamentik, die auch ihn eine zeitlang gefangen nimmt, dass es Zeit wird, eine neue Sprache zu finden, denn: "Die ganze Sprache ist verbraucht." Das ähnelt dem Befund Hugo von Hofmannsthals, der in seinem berühmten "Chandos"-Brief konstatierte, dass ihm die Worte "wie modrige Pilze im Mund zerfallen".
Das gilt es für Rilke zu überwinden, bereits in jenen ersten Gedichten, die ihm bewahrenswert erschienen, und die er zum Teil noch Ende der 1890er Jahre in Prag schrieb, zumindest bewegen sie sich innerhalb des Prag-Sujets. Da zeigt sich eine starke Hochschätzung der Armut bei Rilke, die sich ebenfalls lebenslang durchzieht und seinen gelegentlich kuriosen Hang zum Luxus (Grand-Hotels, Zierrat aller Art, Erste-Klasse-Bahnfahrten) auf merkwürdigen Weise kontrastiert. Er nimmt die einfachen Menschen ernst, sieht sich selbst als einen Pilger auf dem Weg zum einzig wahren Wort des Dichters.
So lesen wir gleich in einem seiner ersten haltbaren Gedichte, die man von den reinen Jugendgedichten unterschieden muss:
In der Vorstadt
Die Alte oben mit dem heisern Husten,
ja, die ist tot. - Wer war sie? - Du mein Gott,
sie gab uns nichts, - ihr gab man Hohn und Spott...
Kaum, dass die Leute ihren Namen wussten.
Und unten stand der schwarze Kastenwagen -
Die letzte Klasse; als der Totenschrein
sich spreizte, stieß man fluchend ihn hinein,
und dann ward rauh die Türe zugeschlagen.
Der Kutscher hieb in seine magern Mähren,
und fuhr im Trab so leicht zum Friedhof hin,
als wenn da nicht ein ganzes Leben drin
voll Weh und Glück - und tote Träume wären.
Das ist ein gutes Gedicht Rilkes, geschrieben mit Anfang zwanzig, gut, weil darin nichts gelogen ist - auch wenn sich die Form natürlich verändern wird, in der Rilke sich ausdrückt. Später schreibt Rilke anders: distanzierter, kälter und härter. Er will jeden Anflug von Erbaulichkeit aus seiner Dichtung austreiben - bis hin zu den "Duineser Elegien", den "Sonetten an Orpheus" und dem lautmalerisch-experimentellen "Gong"-Gedicht, der 1920er Jahre in der Schweiz.
Es ist merkwürdig: Als das „Stunden-Buch“ Ende 1905 im Insel Verlag erscheint, ist dies für Rilke wie ein Dokument seiner Jugend, die im Empfinden des neunundzwanzigjährigen Dichters lange schon hinter ihm liegt. Er ist längst über Rodin hin zur Welt der „Neuen Gedichte“ (der kühlen Ding-Gedichte) und der „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ durchgedrungen.
Mit dem „Stunden-Buch“ erreicht er erstmals einen größeren Leserkreis. Es wird zum Triumph einer Rilke selbst höchst problematisch gewordenen Auffassung von Dichtung. Rilke verleugnet diese nicht, sie hat ihre Vorzüge ebenso wie ihre Schwächen. Sie gehört zu ihm, gewiss, aber wichtiger ist für ihn: Er ist über die „Stunden-Buch“-Welt hinaus und will auch nicht wieder in sie zurückgezogen werden. Dennoch ist er mit der Art und Weise, wie der Insel Verlag „Das Stunden-Buch“ herausgebracht hat, überaus zufrieden.
Den drei Teilen „Das Buch vom mönchischen Leben“ (1899), „Das Buch von der Pilgerschaft“ (1901) und „Das Buch von der Armut und vom Tode“ (1903) ist die Widmung vorangestellt: „Gelegt in die Hände von Lou“. Mit diesem Buch vollzieht er den Wechsel vom Verlag Axel Juncker zum Insel Verlag, wo er sich bald eng an den Verleger Anton Kippenberg und seine Frau Katharina anschließen wird. Juncker ist tief enttäuscht, dass er Rilke ziehen lassen muss. Als das „Stunden-Buch“ erscheint, weilt Rilke bei Rodin in Meudon, wohin ihn dieser eingeladen hatte.
Sein neuer Förderer Karl von der Heydt bespricht das „Stunden-Buch“ in den „Preußischen Jahrbüchern“. Es ist eine freundlich anerkennende, fast schon rühmende Besprechung – jedoch der Ton zeigt den Bankier mehr als den Enthusiasten. Da ist von „Gipfeln der deutschen Lyrik die Rede“, von Rilkes „überreicher Technik“, aber auch von „Geisterbeschwörungen“. Von der Heydt erkennt – stellvertretend für viele zeitgenössische Leser – im „Stunden-Buch“ vor allem „Gebetsstimmungen“, das „Suchen der Seele nach Gott“.[i] Dass dies für Rilke keine Einbahnstraße ist, dass – ganz im Sinne der Mystik – auch Gott nach der Seele des Einzelnen sucht, entgeht von der Heydt.
Rilke ist von der Insel-Buchgestaltung fasziniert. Denn für ihn bleibt ein Buch immer ein Gesamtkunstwerk, bei dem es auf jedes Detail ankommt. So schreibt er am 6. Januar 1906 an Carl Ernst Poeschel, den scheidenden Mitverleger von Insel: Das Stunden-Buch in seiner jetzigen Form wird mir mit jedem Tag vertrauter: ich lese darin wie in meinem Manuscript; der Druck ist herrlich stark und klar, ganz wie ich ihn wünschte.[ii]
Das „Stunden-Buch“, vor allem sein erster – umfangreichster – Teil „Das Buch vom mönchischen Leben“ nimmt die Wendung vom „Stundengebet“ der mittelalterlichen Liturgie auf. Mittelalterliche Stundenbücher haben zuerst einen kalendarischen Sinn. Sie strukturieren das Jahr wie den Tag mit der Absicht, ihn zu heiligen. Winter und Sommer, Tag und Nacht, Schlafen und Wachsein, Licht und Dunkel, Ruhe und Arbeit, zuletzt auch Leben und Tod werden in einen zyklischen Zusammenhang gebracht – gleichsam in den ewigen Wechsel von Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
Zwischen Gebet und Buch gibt es im Mittelalter einen engen Zusammenhang, ebenso mit der Malerei. Vor der Erfindung des Buchdrucks sind es Werke der Buchmalerei, deren berühmtestes vielleicht das „Stundenbuch des Herzogs von Berry“ ist. Nach dessen Tod 1416 fanden sich zahlreiche Handschriften in seinem Nachlass, darunter 15 Stundenbücher. Diese waren zum Gebrauch für Laien bestimmt, die sich, dem Vorbild der Mönche und Priester folgend, zu festgelegten Zeiten dem Gebet widmen wollten. Aber es sind mehr als nur Bilderfolgen der Bibel, hier wird auch die Brücke zum profanen Leben geschlagen. Denn Stundenbücher zeigen die Zeit an, zählen auch die Stunden, die jedem noch bleiben. Dieses Zugleich von religiösem und profanen Inhalt fasziniert Rilke. Schließlich nimmt er sich im Paris des Jahres 1905 drei frühe Gedichtzyklen vor – und fügt sie zu einem einzigen großen zusammen. Dabei geht es ihm zuerst um einen in Ausdruck verwandelten Rhythmus, der dem langen Atem des Beters folgt. Aber das sollte man nicht mit dem Gebet zu Gott in traditioneller Weise verwechseln, wie es nach dem Erscheinen des „Stunden-Buchs“ häufig geschah.
Es ist tatsächlich viel von Gott darin die Rede – und der Irrtum, man lese hier die Gedichte eines von seiner Frömmigkeit getragenen Gottsuchers, also genuin religiöse Dichtung, wurzelt vor allem im ersten Teil des „Stunden-Buchs“. Aber es ist nur bedingt der christliche Gott, um den es hier geht – so viel und so wenig es in den Schriften der Mystiker von Meister Eckhart bis Angelus Silesius um diesen geht. Beide Autoren kennt Rilke, der als Dichter keinen Ehrgeiz darein setzt, besonders viele Bücher zu lesen. Aber diejenigen, die er liest, liest er auf eine besondere, eine innige Weise. Bei Meister Eckhart wohnt Gott auf dem Grunde der Seele des Einzelnen, der sich in sich versenken, „Wesensschau“ halten muss, um gleichzeitig Gott und sich selbst zu erkennen. Um dieses Verhältnis von Ich und Gott geht es auch im „Buch vom mönchischen Leben“. Gott erscheint hier also gleichsam als das andere zum Ich, ein Gegenüber, das kein unpersönliches Prinzip ist. Ein Wegbegleiter, an den man das Wort richtet und gegenüber dem man gleichzeitig auf Antwort lauscht.
Wie auch Angelus Silesius glaubt Rilke nicht an die Existenz Gottes außerhalb dieser Ich-Du-Beziehung. Darum erscheint hier Gott als Verbindung zwischen dem Kleinsten (das franziskanische Prinzip der Minoriten, der minderen Brüder) und dem Größten, der Alleinheit. Eines ist nicht ohne das andere.
Bei Angelus Silesius lesen wir: „Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein; Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.“ Oder auch: „Gott ist mir das Feu´r, und ich in ihm der Schein: Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?“[iii]
Ganz Ähnliches erfahren wir von Gott im „Buch vom mönchischen Leben“. Da ist vom Nachbar Gott die Rede und wird auch gesagt, woran er glaube: Ich glaube an Nächte. Und auch: Ich glaube an alles noch nie Gesagte.[iv]
Im Grunde scheint es eine Abfolge von Innenansichten eines Werdenden zu sein, ein fortwährend variiertes Bekenntnis wie es sich gleich im ersten Gedicht des „Stunden-Buchs“ findet: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die Dinge ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, / aber versuchen will ich ihn.[v]
Da hat jemand einen starken Willen zur Transzendenz, dem Überschreiten-Wollen des bloß Diesseitigen, aber gleichzeitig eine Scheu vor dem Jenseits. Darum ist das von Rilke gemeinte Jenseits ebenso ein Diesseitiges. Transzendenz und Immanenz durchdringen einander – entscheidend ist der Impuls des Überschreiten-Wollens.
In einem für das „Stunden-Buch“ bezeichnenden Gedicht im „Buch vom mönchischen Leben“ heißt es: Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? / ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) / Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) / Bin dein Gewand und dein Gewerbe, / mit mir verlierst du deinen Sinn.[vi] Damit ist deutlich gesagt, Gott ist nichts ohne den Glaubenden, er ist sogar nur durch ihn!
Warum gibt Rilke nun mit dem „Stunden-Buch“ einen Gedichtzyklus heraus, den er ganz offensichtlich bereits zurückgelassen hat? Schließlich arbeitet er gerade an Gedichten, die einen ganz anderen Ton haben und auch an den keinem direkten Vorbild mehr folgenden „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“? Vielleicht weil ihn die Frage nach dem umtreibt, was von einem Sagen bleibt, das sich ganz offensichtlich bereits überlebt hat?
Beim ersten Aufenthalt bei Rodin (1901 in Paris) hatte ihn dessen harte Forderung nach dem "Toujours travailler" - „Immer arbeiten!“ fast erschlagen, nun beginnt er, im Rückgriff auf seine frühen Gedichte, sich davon zu distanzieren, ohne es ganz zu dementieren. Er weiß inzwischen, dass er das nicht kann, immer arbeiten, das hieße ständig neue Werke zu produzieren. Das will er auch nicht mehr – und um diese neue Position zur Arbeit zu formulieren wird das „Stunden-Buch“ ihm notwendig.
In gewisser Weise folgt er darin nicht nur Franz von Assisi und seinem Lob der Armut (das auch die geistige Armut mit einschließt), sondern bereits dem heiligen Benedikt und seiner Klosterregel „Ora et labora“. Man muss nicht nur arbeiten, sondern auch beten! Das übersetzt der entlaufene Prager Katholik auf seine Weise: Der Geist muss Atem schöpfen können.
Franz von Assisi ist im „Stunden-Buch“ ebenso präsent wie Rilkes Erfahrung mit den russischen Menschen. Für den Bildhauer und Schriftsteller Ernst Barlach wird 1906 dessen Russland-Reise zu ebensolcher Erschütterung (ein Weckruf zum Wesentlich-Sein), wie sie es auch für Rilke war.
Barlach wird nicht selten – und ebenso missverständlicherweise – für einen religiösen Künstler gehalten. Auch er ist auf einer Pilgerreise, in der Gott und Mensch letztlich ununterscheidbar werden. Sein Menschenbild wurzelt in der Würde von Armut, wenn er bekennt, seine Lieblingsthemen seien: „Bettler, Beter mit ihrem Nichts vor dem Tiefsten und Höchsten.“[vii]
All unsere Gebete sind letztlich Selbstgespräche, die über uns hinausweisen. Sie bezeugen ein Unterwegssein, wie der Titel des zweiten Teils des „Stunden-Buchs“ sagt: „Von der Pilgerschaft“. Hin zum anderen, der uns zum Gegenüber wird, wie der „liebe Gott“ in Rilkes Geschichten, die doch ebenso Geschichten von uns sind?
Rilkes Nähe zur Mystik hat ihren Grund nicht zuletzt darin, dass er, wenn er über Geist und Glaube spricht, das Poetische als eigentliche Verheißung darin sucht. Mit anderen Worten: Ein Autor, der ohne gestaltende Phantasie, ohne den Willen zur Selbsterforschung ist, interessiert ihn nicht. Die Bibel ist ihm ein Buch prallvoll von wunderbar kraftvollen wie zarten Geschichten, die uns alle unmittelbar angehen. In poetischer Hinsicht bleibt sie unübertroffen. Alles Prophetische hat für Rilke nur einen Wert, wenn es eingebunden ist in einen überzeugenden Ausdruck, der für sich steht.
Thomas‘ von Kempens „Nachfolge Christi“ („Imitatio Christi“) von 1418 ist ihm aus dem gleichem Grunde nahe, denn sie erzählt von unseren Nöten, geboren zu werden und sterben zu müssen. Es wird damit gleichsam zu einem existentialistischen Werk. Bei Thomas von Kempen können wir lesen, was auch Franz von Assisi über den Besitz von Wissen sagte, der wie aller Besitz schädlich sei: „Laß ab von der überspannten Wissbegier; denn es ist viel Zerstreuung und viel Trug dabei. Die viel wissen, wollen auch den Schein haben, dass sie viel wissen und hören es gern, wenn man von ihnen sagt: Siehe, das sind weise Männer! Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, deren Erkenntnis der Seele wenig oder nichts einträgt. Und auf etwas anderes sinnen, als was das Heil der Seele fördern hilft – dazu gehört wahrhaftig ein großes Maß an Torheit. Viel Worte machen, das stillt den Hunger der Seele nicht.“[viii] Das ist exakt die Position Rilkes im „Stunden-Buch“ – und diese will er mitnehmen, wenn er nun in Paris ganz anders schreiben wird. Aber auch die Gegenposition soll präsent bleiben, sie muss das beeinflussen, was jetzt an Neuem entstehen soll. Das Paradox, so weiß er, gilt es auszuhalten, ebenso wie den Widerspruch zwischen Wissen und Glauben.
Auch Lou erfährt von diesem ihn beherrschenden Widerspruch, wenn er gleichzeitig über Göttingen als einem kleineren deutschen Universitätsort spricht, der einen wohltuenden Einfluss auf ihn haben könnte (mit Lou in der Nähe!), der Brief vom 13. Mai 1904 jedoch mit einer prinzipiellen Absage an die ´Bildung an sich´ anhebt: Universitäten haben mir ja bis jetzt jedesmal so wenig gegeben; in meinem Gefühl ist soviel Abwehr gegen ihre Art. ...dass ich, unter Büchern allein gelassen, ein Hülfloser bin, ein Kind, das man wieder herausführen muss, hält mich jedesmal auf, macht mich bestürzt, traurig, rathlos.[ix]
Von intellektuellen Männerrunden, wo mit Zitaten umhergeworfen, mit Belesenheit geglänzt wird, fühlt sich Rilke ausgeschlossen. Er bekennt, Männer sehe er nur ihm unverständliche Aktionen machen Frauen dagegen rührten ihn.
Dieses Gefühl des Ausgeschlossen-Seins, anders zu sein als die anderen, beherrscht ihn seit der Kindheit. Darin gründet auch jene Einsamkeit, die Rilke, um ihr nicht zu erliegen, rühmen muss.
Das dritte Buch, „Von der Armuth und vom Tode“, wendet sich explizit Franz von Assisi und der von ihm gelebten Armut zu. Und gleichzeitig wird darin ein Thema sichtbar, das für ihn hier in Paris bestimmend werden wird, ohne das etwa „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ nicht denkbar sind: die Frage nach der Stellung des Todes zum Leben. Im „Stunden-Buch“ ist es als eine inständige Bitte formuliert: O Herr, gib jedem seinen eignen Tod ... Rilke spricht vom kleinen Tod als einer Frucht, die nicht reift. Der Gegensatz dazu ist der große Tod, das sei die Frucht, um die sich alles dreht.[x]
Für Rilke ist klar, ohne einen eigenen Tod geht ein Leben nicht erfüllt zu Ende. Aber wer hat schon noch einen eigenen Tod? Diese Frage wird er, nicht in Gebetform, sondern kühl analysierend in den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ zu beantworten versuchen.
Das „Stunden-Buch“ endet mit der Verklärung der Armut: Denn Armut ist ein großer Glanz aus Innen ...[xi] Das hat bei sozialpolitisch gestimmten Naturen Befremden ausgelöst. Gilt es nicht die Armut zu überwinden, statt sie derart als großen Glanz aus Innen festzuschreiben? Aber dieser Einwand verkennt Rilkes Intention. Dass man Armut beseitigen solle, wo es nur geht, dem wird er – nicht zuletzt in eigener Sache – jederzeit zustimmen. Aber dass Armut nicht gleichbedeutend mit Elend sein muss, dass sie – wo sie ihre Würde wahrt – Achtung und nicht Mitleid verdient, ist das, worum es Rilke hier geht. Armut im Sinne Franz von Assisis ist eine freie Entscheidung gegen den Besitz, gegen das Geld! Davon zeugt das Leben Franz von Assisis, dem Rilke sogar eine Monographie widmen wollte. Aber da er sich just zu dieser Zeit entschied, keinesfalls mehr um des bloßen Broterwerbs zu schreiben, sondern nur noch das, was seiner dichterischen Mission notwendig sei, blieb sie ungeschrieben.
Doch am Ende des „Stunden-Buchs“ finden sich Spuren dieses ungeschriebenen Buches über Franz von Assisi, der den Heiligen und den Ketzer in sich vereinigte: O wo ist der, der aus Besitz und Zeit / zu seiner großen Armut so erstarkte, / daß er die Kleider abtat auf dem Markte / und bar einherging vor des Bischofs Kleid.[xii] (Dies bezieht sich auf den authentischen Moment in Franz´ Leben, wo er sein bürgerliches Kleid auszieht und nackt vor dem Bischof steht - bereit für ein neues Leben.)
Allerdings ist Rilke dabei nicht immer stilsicher – dann, wenn er sich von Sentimentalität überwältigen lässt. Das betrifft nicht nur die Schlusswendung des „Stunden-Buchs“ von Armut großer Abendstern,[xiii] sondern auch einige Reimereien, die er sich jetzt in Paris nicht mehr durchgehen lassen wird. Und nun stehen sie hier direkt nebeneinander. Einerseits auf den bloßen Reim hingeschriebene Verse, wie dieser: und du: du bist aus dem Nest gefallen / bist ein junger Vogel mit gelben Krallen / und großen Augen und tust mir leid. / (Meine Hand ist viel zu breit.)[xiv] Auf der anderen Seite steht Rilkes frappierend genauer Sinn für atmosphärische Veränderungen in der Zeit, für geistige Umbrüche, von dem bereits im 1899 entstandenen ersten Teil des „Stunden-Buchs“ zu lesen ist: Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht.[xv]
Rilke ahnt, dass sich die Grundkoordinaten der Welt gerade dabei sind, dramatisch zu verändern. Was bedeutet das für die Frage nach Gott, und die Sprache der Dichtung? In einem berühmten Brief an Lotte Heppner aus München vom 8. November 1915, mitten im Ersten Weltkrieg geschrieben, lesen wir: "Wie ist es möglich zu leben, wenn doch die Elemente dieses uns völlig unfasslich sind?" Es gibt keinen Sinn, das tradierte Sinn-Gefäß ist zerbrochen, es gibt nur noch Sinn-Splitter, die es aufzulesen - und vielleicht neu zusammen zu setzen gilt. Er schreibt weiterhin über Tolstois "Tod des Iwan Iljitsch: "...gerade deshalb konnte dieser Mensch so tief, so fassungslos erschrecken, wenn er gewahrte, dass es irgendwo den puren Tod gab, die Flasche voll Tod oder diese häßliche Tasse mit dem abgebrochenen Henkel und der sinnlosen Aufschrift "Glaube Liebe Hoffnung", aus der einer Bitternis des unverdünnten Todes zu trinken gezwungen war." Das klingt wahrlich nach einer Stimme mitten aus dem großen Krieg, der nicht nur Leben und Städte vernichtet, sondern auch den Worten ihren Sinn nimmt.
In "Der Brief des jungen Arbeiters" dann, einem fiktiven Brief, im Februar 1922 auf Schloss Muzot im Schreibrausch zwischen der zehnten und fünften Duineser Elegie geschrieben, heißt es bündig: "Es treibt mich zu sagen: Wer, ja, - anders kann ich es nicht ausdrücken, w e r ist denn dieser Christus, der sich alles einmischt." Das klingt nach schroffer Ablehnung des Christentums - und das ist es auch. Die Einschränkung, die er jetzt noch macht, betrifft nur Franz von Assisi, der glaubwürdig ist in seiner Lebenbejahung, die den Tod nicht scheut, aber diesen nicht gegen das Leben stellt: "Das Hiesige recht in die Hand zu nehmen, herzlich liebevoll, erstaunend, als unser, vorläufig. Einziges: das ist zugleich, es gewöhnlich zu sagen, die große Gebrauchsanweisung Gottes, d i e meinte der heilige Franz von Assisi aufzuschreiben in seinem Lied an die Sonne, die ihm im Sterben herrlicher war als das Kreuz, das ja nur dazu da stand, in die Sonne zu w e i s e n."
Das Feindbild: die Kirche und ihre Macht, die aus Dogmen und Institution erwächst. Rilke in seinem "Brief des jungen Arbeiters": "Hier ist der Engel, den es nicht giebt, und der Teufel, den es nicht giebt; und der Mensch, den es giebt, ist zwischen ihnen, und, ich kann mir nicht helfen, ihre Unwirklichkeit macht ihn mir wirklicher."
Warum reist Rilke im November 1912 nach Spanien? Er will El Grecos Bilder sehen und die Stadt, in der sie entstanden. Im Jahr zuvor hatte er in München bereits El Greco-Gemälde gesehen, die ihm in ihrer Ausdruckswucht unvergleichlich schienen.
Aber noch etwas anderes lässt ihn so plötzlich zu dieser Reise aufbrechen, etwas Absurdes, geradezu Lächerliches. Ende September, Anfang Oktober hat Rilke auf Duino an mindestens zwei Séancen teilgenommen, die Marie von Thurn und Taxis veranstaltete. Die Prokolle dieser Séancen legt sie Rilke in einem Brief vom 3. Oktober bei. Eine „Unbekannte“ tritt darin auf und gibt nebulös formulierte Antworten auf wie bei einer Quiz-Show klingende Fragen. Der Kontakt mit der Welt der Toten hat etwas Bizarres, geradezu etwas von einem Puppentheater, in dem alle vom Kasper etwas Genaues wissen wollen und dieser so ungenau wie möglich antwortet. Das Ergebnis liest sich dann so vorhersehbar blumig wie schlechte Lyrik.
Auf diesen fünfzehn Seiten Gespenster-Protokoll findet sich auch der Name Toledo, ein Ort, der Antwort auf drängende Fragen geben soll. Es ist die – verworrene – Rede von einer Brücke, die man suchen solle. „Auf der Brücke schaue hin, dann wirst du mich fühlen.“[xvi]
Ein makabres Spiel zur Unterhaltung auf dem einsamen Schloss? Das auch, aber Rilke lässt sich erstaunlicherweise auf diese Trivialvariante des Lebens der Toten ein, nimmt die Szenerie wenigstens halbwegs ernst. So ernst immerhin, dass er kurz darauf tatsächlich nach Toledo aufbricht. Von der Entstehung der „Weißen Fürstin“ wissen wir, dass Rilke immer mal wieder, besonders in depressiven Phasen, Momente hatte, wo er geisterhafte Gestalten erblickte, die ihm Angst machten.
Rilke, der im „Stunden-Buch“ noch betete, wenn er dichtete, hat sich inzwischen völlig aus jedem christlichen Deutungshorizont befreit. Das zeigt sich bei verschiedenen Anlässen, etwa seiner Reise nach Córdoba und Sevilla. Aus Ronda schreibt er am 17. Dezember 1912 an Marie von Thurn und Taxis einen langen Brief, in dem es auch um Spanien als katholisches Land geht. Er sei hier von einer beinah rabiaten Antichristlichkeit, gesteht er ihr. Diese Entleerung eines einst starken Gefühls! Jetzt ist hier eine Gleichgültigkeit ohne Grenzen, leere Kirchen, vergessene Kirchen, Kapellen, die verhungern, – wirklich man soll sich länger nicht an diesen abgegessenen Tisch setzen ... Die Frucht ist ausgesogen, da heißts einfach, grob gesprochen, die Schalen ausspucken.
Stattdessen lese er jetzt den Koran – die Art, wie der spanische Katholizismus hier die einstigen Moscheen überbaute, stößt ihn ab. In diesem langen Brief versteigt sich Rilke sogar zu einem Vergleich, dem ihm christlich gestimmte Leser übel genommen haben. Das Gebet wird darin zum Telephon „Christus“, in das fortwährend hineingerufen wird: „Holla wer dort?“, und niemand antwortet.[xvii]
Man könnte dem mit etwas Bosheit hinzufügen, dass dies das Gebet von einer bloßen Geisterbeschwörung unterscheidet, wie sie Rilke in seiner Séance auf Duino erlebt hatte. Wer will schon solch offensichtlich trashige Antworten auf die tiefsten Fragen seiner Existenz erhalten?
Rilkes Telefon-Vergleich ist überspitzt formuliert und erschöpft das Thema Christus keineswegs. Aber Rilke sieht sich hier in Spanien mit einer Übermacht an traditionellem Katholizismus konfrontiert, auf die er als katholisch getaufter Prager – der aus der Kirche austrat – nur mit reflexartiger Abwehr reagieren kann. Er weiß sich dabei an der Seite El Grecos, dieses Malers einer völlig neuen Art von Apokalypse.
El Grecos „Laokon“ von 1610 hatte er in München gesehen, und seitdem lässt ihn dessen Bild von Toledo nicht mehr los. Welch expressive Kraft, die die Grenzen eines Kunstwerks sprengt, tritt ihm hier entgegen!
Von Duino aus also reist er im Herbst 1912 nach Toledo, nicht ohne zuvor seinem Verleger Anton Kippenberg diese Unternehmung zu begründen. Er wolle nicht wie ein Tourist reisen, schnell etwas sehen und dann weiter, sondern gedenke sich in Toledo niederzulassen. Er habe vor, sich mit El Greco zu befassen, der zu den größesten Ereignissen meiner letzten zwei oder drei Jahre gehört.
Großes erhofft er sich, erwartet die Erschütterung, die ihn anders sehen, anders schreiben lässt: Vielleicht übertreibe ich: aber mir will scheinen, als ob diese Reise von ähnlicher Bedeutung für meinen Fortschritt sein würde, wie es einst die russische war ...[xviii]
Am 4. Dezember, da ist Rilke genau vier Wochen in Toledo gewesen, schreibt er an Marie von Thurn und Taxis, nun sei er nach Sevilla weitergereist, eine Stadt, von der er nichts erwartet habe, und sie giebt mir auch weiter nichts; wir haben einander nichts vorzuwerfen[xix].
Spanien, das ist eben kein süßer Traum vom Süden, sondern harte Realität, die mit einem zwiespältigen Erbe von Macht und Gewalt zu tun hat – im Namen des Christentums.
Kann der geniale Maler El Greco diese Wucht, mit der die Wirklichkeit über ihn hereinbricht, in einem bezwingenden Bild kontern? Ja, aber auf eine erschreckend nüchterne Weise, wie Rilke bemerkt: Übrigens ja, ich sah noch viel Greco in Toledo, mit immer mehr Einsicht und immer reinerer Ergriffenheit; ganz zum Schluss die Himmelfahrt in San Vicente: ein großer Engel drängt schräg ins Bild hinein, zwei Engel strecken sich nur, und aus dem Überschuss von alldem entsteht purer Aufstieg und kann gar nicht anders. Das ist Physik des Himmels.[xx]
Man fragt sich, was hat Rilke überhaupt mit Spanien abzumachen? Nichts, es geht gar nicht um Spanien und seinen martialisch hochgerüsteten Katholizismus, vor dessen Überresten Rilke wie vor einer entseelten Ruinenlandschaft steht, es geht um ihn selbst: Ich sage Ihnen, Fürstin (nein, nein, Sie müssen mirs glauben), es muß mit mir anders werden, von Grund aus, von Grund aus, sonst sind alle Wunder der Welt umsonst.[xxi]
Rilke sieht Europa vor einer großen Erschütterung stehen, einer Katastrophe gar und fragt sich, wozu ein Krieg gut sein soll. Zu nichts, denn er bringt nur Zerstörung. In Ronda habe ihn dann ein übermächtiges Gefühl von Angst überfallen, die nicht weichen wolle.
Rilke steht im Banne einer Depression, einer übermächtigen Vernichtungsdrohung. Spanien hat etwas, das ihn krank macht, auch wegen der abgründig-dunklen Bilder, die es in ihm weckt. Die sind nicht von gestern, eher von morgen. Auch das zeigt ihm der Visionär El Greco – und Rilke wird das Gesehene weiter in sich tragen, es Schritt für Schritt in innere Bilder verwandeln, bis fast ein Jahrzehnt später, als er die Duineser Elegien beendet, diese Bilderwelt in den Duineser Elegien über ihn kommt. Und das wie immer, wenn er Vergangenheitstiefes auf neue Art zu sagen hat: wie unter Diktat.
Auch bei El Greco ist der Engel schrecklich, gewiss, aber was folgt für Rilkes Zukunft daraus? In sein Tagebuch wird er am 14. Januar 1913 notieren: Möglicherweise ist es meine nächste Stufe, dies zu lernen; die Realität der Engel nach der Realität der Gespenster. Der Engel bei El Greco sei nicht mehr anthropomorph wie das Thier in der Fabel, auch nicht mehr das ornamentale Geheimniszeichen des byzantinischen Gottesstaates.
In diesem Engel erst übertreffe der Engel den Vogel: nicht daß er fliegt ist ihm entscheidend, denn der Flug ist auf beiden Seiten begrenzt, ein Intervall des Aufruhens; er streckt sich sinnlich ins Übersinnliche, nur das Strecken ist unaufhörlich, parallel, hat seinen Anfang und entgeht in die Unendlichkeit.[xxii]
Im Februar 1913 verlässt Rilke Ronda, er fühlt sich krank, und das will er nicht allein aufs schlechte Wetter schieben, das hier herrscht und ihn frieren lässt. Nein, er friert in gleichsam metaphysischer Hinsicht. Der alte christliche Glaube lässt sich nicht wiedererwecken, das ist ihm längst klar. Aber kann der Mensch ohne Religion, ohne die Frage nach Gott leben? Nicht, wenn er die Wahrheit über sich sucht, als Sterblicher angesichts der darüber höchst gleichgültigen Ewigkeit.
Diese tödliche Einsicht, dass unser Schicksal nicht sonderlich schwer wiegt in dieser Welt, die nicht bloß die sichtbare ist, arbeitet seit Spanien in Rilke. Innen und Außen, das ist ein Drama, das es erst zu begreifen und dann zu gestalten – und somit zu ertragen – gilt.
Darüber schreibt er mitten im Ersten Weltkrieg aus München am 27. Oktober 1915 an Ellen Delp: ... Erscheinung und Vision kamen gleichsam überall im Gegenstand zusammen, es war in jedem eine ganze Innenwelt herausgestellt, als ob ein Engel, der den Raum umfaßt, blind wäre und in sich schaute. Diese nicht mehr vom Menschen aus, sondern im Engel geschaute Welt, ist vielleicht meine wirkliche Aufgabe ...[xxiii]
Da sind wir dann beim Engel der Duineser Elegien, der kein christlicher Engel ist, sondern ganz Rilkes Engel, über den er sagt: "Ein jeder Engel ist schrecklich." Das findet sich in der ersten Elegie. Aber auch die zweite hebt als Wiederholung an: "Jeder Engel ist schrecklich." Rilkes Engel sind keine Mittler mehr zwischen Himmel und Erde, keine Himmelsboten, sondern "fast tödliche Vögel der Seele", Türwächter der Dichtung. In der ersten Elegie heißt es: "Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehn oder Toten." Seinem polnischen Übersetzer Witold Hulewicz schreibt er am 13. November 1925 zur Erklärung: "Der Engel der Elegien ist dasjenige Geschöpf, in dem die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, die wir leisten, schon vollzogen scheint... Der Engel der Elegien ist dasjenige Wesen, das dafür einsteht, im Unsichtbaren einen höheren Rang der Realität zu erkennen. Daher ´schrecklich´ für uns, weil wir, seine Liebenden und Verwandler, doch noch am Sichtbaren hängen. Alle Welten des Universums stürzen sich ins Unsichtbare, als in ihre nächsttiefere Wirklichkeit."
Das ist dann die neue Realität, ebenso anonym wie unsichtbar. Ohne Grenzen, doch uns gefangensetzend:
Das existenzialistische Programm des 20. Jahrhunderts, den Schrecken des ersten Weltkriegs, die Trümmer des alten Europas im Rücken:
So hebt die erste Duineser Elegie an, die - das zeigt Rilke als Visionär - bereits 1912 auf Duino geschrieben wurde:
Wer, wenn ich schriee, hörte mich den aus der Engel
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf
dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen
wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht,
und die findigen Tiere merken es schon,
daß wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind
in der gedeuteten Welt.
[i] Rilke, Briefe an Karl und Elisabeth von der Heydt, 246
[ii] Ingeborg Schnack, Rilke-Chronik, 230
[iii] Angelus Silesius, Der cherubinische Wandersmann, 2
[iv] Rilke, Das Stunden-Buch, 12
[v] ebd., 7
[vi] ebd., 26
[vii] Ernst Barlach, Briefe I, 492
[viii] Thomas von Kempen, Nachfolge Christi, 14
[ix] Rilke / Lou Andreas-Salomé, Briefwechsel, 164
[x] Rilke, Stunden-Buch, 86
[xi] ebd., 94
[xii] ebd., 101
[xiii] ebd., 102
[xiv] ebd., 18
[xv] ebd., 10
[xvi] Rilke / Marie von Thurn und Taxis, Briefwechsel, Bd. 2, 903
[xvii] Rilke, Briefe (Hg. H. Nalewski), Bd. 1, 448
[xviii] Rilke / Anton Kippenberg, Briefwechsel, Bd. 1, 351
[xix] Rilke / Marie von Thurn und Taxis, Briefwechsel, Bd. 1, 240
[xx] ebd., 241
[xxi] Rilke / Marie von Thurn und Taxis, Briefwechsel, Bd. 1, 247
[xxii] Rilke, Tagebuch, in: Rilke in Spanien, 91
[xxiii] Rilke, Briefwechsel mit Regina Ullmann und Ellen Delp, 91